„Die Generation(en) der Davongekommenen“
Die Kriegs- und Nachkriegsjahre von 1943 bis 1948 haben sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt: die Nächte im Luftschutzkeller, der Donnerschall explodierender Bomben, die verängstigten Hausbewohner, die im fahlen Schein der Notbeleuchtung auf ihren Stühlen hocken, das Flackern der elektrischen Birnen, wenn in der Nähe Bomben einschlagen, die Rückkehr in die verwüstete Wohnung nach dem Angriff. Diese Ereignisse und Bilder sind, auch wenn sie allmählich an Schrecken verloren haben, nie ganz aus meinem Gedächtnis gewichen. Ich bin ein Kriegskind geblieben. Der 2. Januar 1945 und die Tage danach, der Gang mit meinem Großvater durch das fast völlig zerstörte Nürnberg, gehören zu den unauslöschlichen Erinnerungen an meine Kindheit. Ich sehe mich noch immer an seiner Seite schweigend auf durch Schutt verengte Straßen gehen. Brandgeruch steigt auf. Aus der Trümmerlandschaft ragen Hausskelette, Fassadenteile, Mauerreste, verbogene Rohrleitungen, Treppen ins Nichts.
Menschen schieben Karren vor sich her, beladen mit dem wenigen, das sie gerettet haben. Über allem liegt eine bleierne Stimmung. Fast zweitausend Menschen sind am Abend des 2. Januar 1945 umgekommen, nach manchen wird in den Trümmern noch gegraben. Nach dem Krieg überkommt mich noch lange Zeit ein Schauer, wenn Sirenen aufheulen. Mit jedem Alarmton kehrt der Krieg zurück. Noch Mitte der 1950er Jahre sind nicht alle Trümmerberge abgeräumt. Der Wiederaufbau zieht sich über meine ganze Jugendzeit hin. Mein künftiges Leben wird davon bestimmt. Als ich 1955 in Hannover an der Werkkunstschule Malerei und Grafik zu studieren beginne, schaue ich von meinem Fenster aus noch auf Ruinen. Ich bin Jahrgang 1935, werde als so genannter Weißer Jahrgang nicht zur Bundeswehr eingezogen, die eben aufgebaut wird. Mir bleibt der Wehrdienst erspart. Alles Militärische ist mir suspekt, doch die Frage der Wehrdienstverweigerung stellt sich nicht für mich.
Als in viel späteren Jahren im Fernsehen über kriegszerstörte Städte berichtet wird, über Grosny, Gaza Stadt, Aleppo, Damaskus oder Mossul, kehren die Ruinenbilder der Kriegs- und Nachkriegszeit zurück. Die Fernsehbilder wecken Erinnerungen an die Schrecken des Krieges. Ich zucke innerlich zusammen. Und mit diesen Bildern drängen sich mir erneut alte Fragen auf, Fragen nach dem Sinn all dieser Scheußlichkeiten und der Grausamkeiten, die sich Menschen seit alters antun. Warum lässt der angeblich allmächtige, allwissende, allgütige, allgegenwärtige, absolut weise und liebende Gott zu, was, wie so oft in seinem Namen, geschieht? Mich ärgern die bekannten Floskeln, mit denen das angebliche Wirken Gottes beschönigt wird. Zorn überkommt mich, wenn ich über theologische Spitzfindigkeiten nachdenke, mit denen christliche Priester ihren Gott exkulpieren wollen. Ihre stereotypen Denkfiguren und Deutungsschemata sind abgegriffen und angesichts der Ereignisse und Verhältnisse geradezu zynische Beschwichtigungen, so scheint es mir. Den Glauben an einen Gott habe ich längst verloren. Aber die Suche des Wissenschaftlers nach rationalen Antworten ist geblieben.
Ich sehe mich als einen, der davongekommen ist, der das Glück hatte, am Leben zu bleiben. Mehr noch, ich hatte die Chance, als ein vergleichsweise autonomes Subjekt mein Leben gestalten zu können. Mein gleichaltriger Kollege Oskar Negt, ein prominenter Sozialwissenschaftler, wählte für seine „autobiografische Spurensuche“ den Titel „Überlebensglück“ (Steidl Verlag, Göttingen 2016) und reihte sich damit in die „Generation der Davongekommenen“ ein. Ein treffender Titel für uns traumatisierte Kriegskinder mit ihren schmerzhaften Erfahrungen und schrecklichen Erlebnissen. Sein Lebenslauf wurde wie der meine von gemeinsamen Erfahrungen geprägt. Sie drängen uns offenbar gleichermaßen, darüber zu berichten. Oskar Negt sieht sein Überlebensglück und sein gelungenes Leben nicht als schicksalhaftes, von oben beschiedenes Überleben an, schon gar nicht als eine göttliche Fügung, sondern als etwas existenziell Gegebenes, das er aktiv bearbeitet hat.
Ich bezeichne es als einen Zufall, dass es mich noch gibt, ja überhaupt gegeben hat. Schon mein Spiel mit dem geladenen Trommelrevolver meines Großvaters hätte tödlich ausgehen können. Hätte die Luftmine, die ein britisches Kampfflugzeug bei einem Luftangriff auf Nürnberg über unserem Wohnviertel abgeworfen hat, nicht unser Wohnhaus treffen und bis auf die Grundmauern zerstören können? Die Bombe schlug zwei Häuserzeilen entfernt ein, zerstörte einen ganzen Straßenzug und tötete Menschen, die wie wir in den Luftschutzkellern gesessen hatten. Leben oder Tod hingen von Zeit und Ort des Ausklinkens einer Bombe ab. Hätte ich nicht in das Fadenkreuz eines feindlichen Tieffliegers geraten können, der am Ende des Krieges unsere Wege unsicher machte? Hätte mich nach dem Kriege nicht einer der Blindgänger zerreißen können, die überall im Boden staken? Überall lauerten tödliche Gefahren. Dass wir Kinder und Jugendlichen davonkamen, verdankten wir nicht allein elterlichem Schutz und Fürsorge, sondern wohl weit häufiger dem blinden Zufall.
Dieser Zufall, davongekommen zu sein und (noch) zu leben, ließe sich sogar noch viel weiter in die Vergangenheit verfolgen: Schon im Dreißigjährigen Krieg hätte die Existenz der Buchdruckerfamilie Mintzel bei den Belagerungen Leipzigs oder bei ihrem äußerst gefährlichen Umzug nach Hof an der Saale im Jahr 1642 enden können. Der einzige überlebende Sohn des Gründers der Mintzelschen Buchdruckerei wurde in Hof bei einem Raubüberfall kaiserlicher Söldnergruppen so heftig an die Wand geschleudert, dass er zeitlebens hinken musste. Der Säugling hatte Überlebensglück. Dass er mit dem Leben davonkam und eine Familie gründen konnte, diesem Zufall verdanke ich in der Kette vieler Zufälle mein Leben. Ich habe diese Chance genutzt, obschon daraus keine Triumphgeschichte geworden ist. Ich habe als ein Davongekommener die Berufsposition eines Hochschullehrers stets als ein Privileg und zugleich als Herausforderung und als die Verpflichtung betrachtet, einen Beitrag zur Befriedung Europas zu leisten.
Beteiligung am deutsch-amerikanischen OMGUS-Projekt in Washington D.C., 1978
Meine Tätigkeit als Hochschullehrer war es auch, die mich im Herbst 1978 in die USA und dort in die Kriegs- und Nachkriegszeit zurückführte. Ich nahm in den USA am deutsch-amerikanischen OMGUS-Projekt teil, in dessen Rahmen eine Riesenmenge an Aktenmaterial aus der US-Besatzungszone gesichtet, ausgewertet und, soweit als historisch relevant eingestuft, verzeichnet und verfilmt wurde. Dazu gehörten auch die OMGUS-Akten des US-Sektors in Berlin. OMGUS war die Abkürzung für “Office of Military Government United States”. Das kostspielige und aufwändige Projekt wurde in Zusammenarbeit des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, des Zentralinstituts für sozialwissenschaftliche Forschung an der Freien Universität Berlin, des Koblenzer Bundesarchivs und der Staatsarchive der westdeutschen Bundesländer durchgeführt. Diese Institutionen sandten im Wechsel jeweils Mitarbeiter nach Washington D.C. Ich war im Auftrag des Landesarchivs Berlin und des Zentralinstituts für sozialwissenschaftliche Forschung beteiligt. Zu meinen Aufgaben zählte auch die Auswertung des Aktenmaterials zum wirtschaftlichen Wiederaufbau Berlins und zur Wiederbelebung der Berliner Wirtschaft nach der Berliner Blockade durch die UdSSR. Eine gewisse Kompetenz hatte ich dafür, weil ich von 1962 bis 1966 an dem Forschungsprojekt „Berlin – Hauptstadtanspruch und Westintegration“ beteiligt gewesen war und zu den Mitautoren des Buches zählte. Der Riesenberg an Archivmaterial war nach der Besatzungszeit in die USA verschifft, dort zunächst nach Kansas gebracht und schließlich nach Suitland/Maryland in eine Dependance der National Archives überführt worden. Wir pendelten werktäglich mit einem Shuttle von Washington D.C. zu unserem Arbeitsplatz in Suitland. Ich wohnte im Hotel „The Coronet“ 200 C Street SE ganz nahe am Capital Hill. Es war eine ereignisreiche und erlebnisintensive Zeit, in der lebenslange Freundschaften begründet wurden. Einer der amerikanischen Projektmitarbeiter, Bryan van Sweringen, wurde in den 1980er Jahren mein Doktorand.
Von Washington D.C. aus unternahmen wir Ausflüge in die benachbarten Bundesstaaten und genossen den Indian Summer. Ich besuchte in Paris/Kentucky zum ersten Mal eine amerikanische Brieffreundin, mit der ich, abgesehen von zeitweiligen Unterbrechungen, seit 1950 korrespondiert hatte. Ellen Ch. Boyd stammte aus Tracy City Tennessee. Sie war mit einem Großunternehmer verheiratet, mit William Stamler, der große Maschinen herstellte und nach Jugoslawien verkaufe.
Der äußerst lehrreiche Aufenthalt führte uns auch die Schattenseiten der USA vor Augen, wir wurden mit den Folgen des Vietnamkrieges konfrontiert, der in der US-Gesellschaft tiefe Wunden hinterlassen hatte, und erlebten buchstäblich hautnah den weit verbreiteten Rassismus. Unsere afroamerikanischen Mitarbeiterinnen verhielten sich scheu und zurückhaltend, sie nahmen an unseren Geselligkeiten nicht teil. Was mir besonders auffiel, war der offene Drogenkonsum weißer Akademikerkreise. Marihuana zu rauchen schien auf abendlichen und nächtlichen Zusammenkünften selbstverständlich zu sein. Ich nahm in einer feucht-fröhlichen Akademikerrunde zum ersten und – ich sage es gleich – zum letzten Mal in meinem Leben an einer Marihuana-Party teil, die mir nicht gut bekam. Obwohl in diesen Jahren auch in Westberlin Drogenkonsum in der antiautoritären Szene üblich gewesen war, hatte ich mich davon stets ferngehalten.
Auf meinen neugierigen Fußwanderungen durch schwarze Wohngebiete und Slums geriet ich während dieses Aufenthaltes in den USA trotz so mancher Mahnung nie in eine heikle oder gar gefährliche Situation. Ein wirklich tief aufwühlender, nachhaltiger Erlebnisschock riss mich psychisch, mental und intellektuell bei einer ganz anderen Begebenheit um, die mich in das Nazi-Deutschland zurückversetzte.
Das Grauen der Vernichtungslager – Das Totenbuch von Mauthausen
John Mendelsohn, ein leitender Angestellter der National Archives in Washington D.C., zuständig für den Records Service und die General Service Administration, lud die Mitarbeiter am OMGUS-Projekt zu einer besonderen Führung und Informationsrunde ins Hauptgebäude der National Archives ein. Mendelsohns Einladung folgten unter anderen Dr. Josef Henke vom Bundesarchiv Koblenz, Reinhard Heydenreuter von der Zentralverwaltung der bayerischen Staatsarchive, Vertreter von Landesarchiven und unsere amerikanischen Mitarbeiter Bruster Chamberlin und Bryan van Sweringen. Mendelsohn hatte wohl mit Bedacht für uns Deutsche „hochkarätige“ originale Dokumente aus der NS-Zeit Deutschlands ausgesucht, die damals schwer oder gar nicht zugänglich waren. Unter den Dokumenten waren die Geheimreden Heinrich Himmlers vor der SS und dessen Randnotizen dazu, ein von Eva Braun, der Lebensgefährtin Adolf Hitlers, geführtes Fotoalbum, das zahlreiche Bilder aus ihrem Privatleben enthielt, das Totenbuch vom Konzentrationslager Mauthausen und zu meiner besonderen Überraschung Akten meines Vaters aus den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. Ich hatte Mendelsohn erzählt, dass mein Vater von 1947 bis 1949 als Verteidiger im Wilhelmstraßen-Prozess mitgewirkt und ich in dieser Zeit den Geheimdienstchef Hitlers, SS-Brigadegeneral Walter Schellenberg, persönlich kennengelernt hatte (siehe Blog Kap.7). Mendelsohn schenkte mir bei dieser Gelegenheit den von ihm gerade (1978) zusammengestellten Bericht über den Fall IX „United States of America v. Otto Ohlendorf et al.“ (Nuernberg War Crimes Trials Records of Case 9).
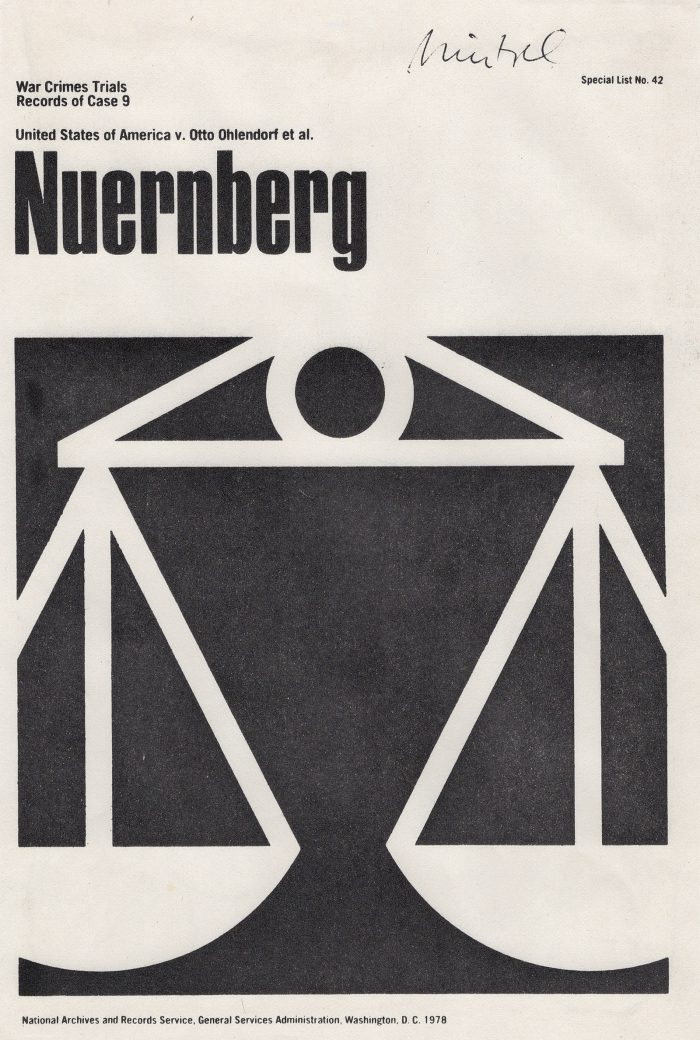
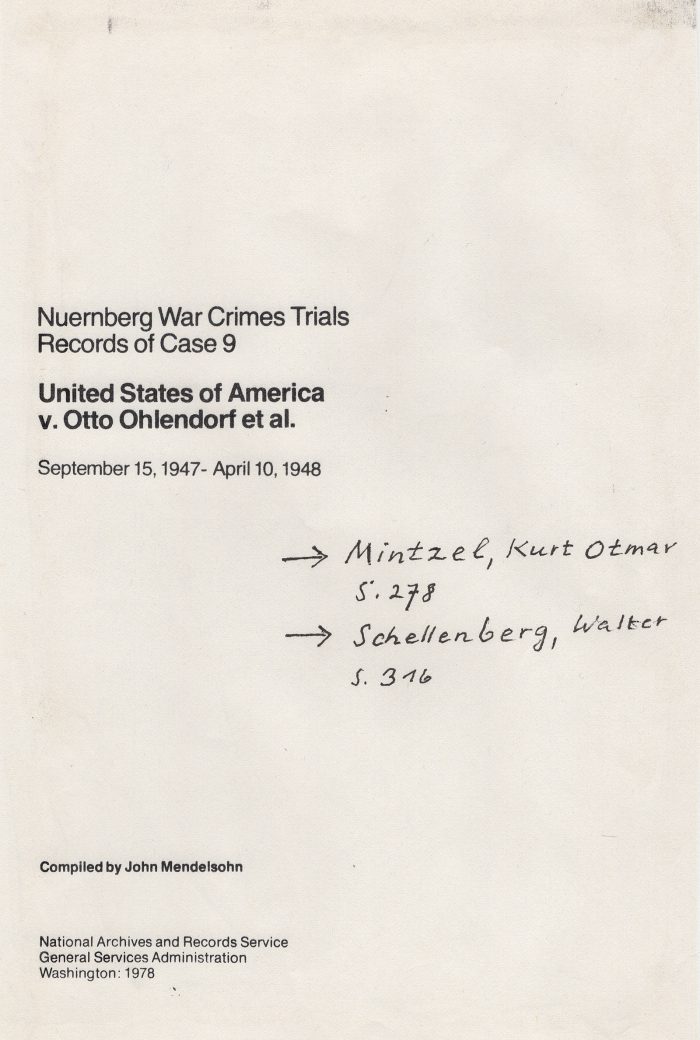 John Mendelsohn, Nuernberg War Crimes Trials, Records of Case 9, United States of America v. Otto Ohlendorf et al., Washington 1978
John Mendelsohn, Nuernberg War Crimes Trials, Records of Case 9, United States of America v. Otto Ohlendorf et al., Washington 1978
Was mich jedoch tief erschütterte und geradezu umriss, war das Totenbuch von Mauthausen. Es löste in mir einen psychischen Ausnahmezustand aus. Die Konfrontation mit diesem Zeugnis des Grauens und des Bösen war unerträglich. Das vom KZ-Personal akribisch-bürokratisch geführte Totenbuch war die bestialische Perversion einer Todesmaschinerie. Mit gestochen schöner Handschrift hatte das KZ-Personal chronologisch die ethnische oder staatliche Zugehörigkeit, die Häftlingsnummer, Namen und Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, angebliche Todesursache und Uhrzeit des Todes eines jeden Ermordeten registriert. Abertausende Eintragungen. In Schönschrift folgt eine Zeile auf die nächste, eine jede ein vernichtetes Menschenleben. Dieses Dokument der NS-Verbrechen in den Händen zu halten und darin zu lesen, wühlte mich innerlich auf und brannte sich in mein Gedächtnis ein. Ich wurde diese entsetzlichen Eindrücke nie wieder los. Damals war es ein außerordentliches Ereignis, weil nur wenigen Personen der Zugang zu den Originaldokumenten gestattet war. Heute ist das längst digitalisierte Totenbuch von Mauthausen für jeden Internetznutzer zu jeder Zeit frei zugänglich. (World War II. War Crimes Records/National Archives, The Mauthausen Concentration Camp Complex/ Mauthausen Death Book; https:www.archives.gov/research…/war-crime-trials.html).
Auch später verlor ich noch in Gesprächen, wenn ich auf dieses Ereignis zu sprechen kam, fast meine Fassung. Mir versagte die Stimme, wenn ich darüber berichtete. Sprache wurde zum hilflosen Gestammel, wollte ich ausdrücken, welches Schockerlebnis diese Horrorstunde in den National Archives in mir ausgelöst hatte. Entsetzen, Schaudern, Erschrecken, Trauer. Mein Vater war als Verteidiger am Fall IX, am sogenannten „Einsatzgruppen-Prozess“ (15.09.1947-10.04.1948) gegen Otto Ohlendorf beteiligt gewesen. Ohlendorf hatte als Leiter der Sicherheits-Organisation im Reichssicherheitshauptamt und der Einsatzgruppe in Südrussland (1941/42) die Ermordung von 90.000 Zivilisten auf dem Gewissen. Er war 1951 hingerichtet worden (siehe Blog Kap. 7). Wie hatte mein Vater seelisch und intellektuell diese Prozesse verkraftet, an denen er als Verteidiger mitgewirkt hatte? Ich hatte ihm in früheren Jahren vorgeworfen, darüber geschwiegen zu haben. Das Totenbuch von Mauthausen, dieses Schockerlebnis in den National Archives, stimmte mich gegenüber der Weigerung meines Vaters, seine Zeitzeugenschaft autobiografisch zu dokumentieren, etwas milder. Wir kamen uns in seinen letzten Lebensjahren in diesen Fragen etwas näher. Er hatte seine nationalsozialistische Vergangenheit weitgehend abgestreift.
So sehr mich die Konfrontation mit den Verbrechen der NS-Diktatur und die Auseinandersetzung mit den Untaten der Vätergeneration bedrückte, lehnte ich es dennoch entschieden ab, eine kollektive Mitschuld und historische Mitverantwortung an diesen Verbrechen zu tragen. Ich sah meine Verantwortung als Hochschullehrer und politischer Zeitgenosse vielmehr darin, vor einer Wiederkehr rechtsradikaler, fremdenfeindlicher und neonazistischer Kräfte zu warnen, mich öffentlich gegen derartige Umtriebe zu stellen und die freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratie der Bundesrepublik Deutschland sichern zu helfen.
Zu Neonazismus und Fremdenhass, 08.11.1992 – Warnung und Appell
Als ich von Passauer Politikern und Gewerkschaftlern gebeten wurde, zum Gedenken an die November-Pogrome 1938 einen öffentlichen Vortrag zu halten und dabei zu den neonazistischen und fremdenfeindlichen Ausschreitungen, Brandanschlägen und Schändungen von Gedenkstätten der Jahre 1991/92 Stellung zu nehmen, fühlte ich mich als Hochschullehrer im Sinne der eigenen historisch-politischen Erfahrungen verpflichtet und herausgefordert, diese Ausschreitungen und ausländerfeindlichen Aktionen, die in neuen und alten Bundesländern stattgefunden hatten, anzuprangern und die Bevölkerung aufzurufen, diesen Umtrieben entschieden entgegenzutreten (PNP Nr. 260, 10.11.1992, S. 28).
In Hünxe (1991), Hoyerswerda (1991), Eberswalde (1991) und Sachsenhausen (1991) Rostock-Lichtenhagen (1992) und Mölln(1992) hatten Brandanschläge auf Asylantenheime, Wohnungen und jüdische Gedenkstätten sowie gewalttätige Ausschreitungen wieder Bilde des hässlichen Deutschland hervorgerufen. Aggressiver Fremdenhass war von Zuschauern beklatscht und von Sympathisanten unterstützt worden. Herumstehende Bürger hatten lebensgefährlicher Brandstiftung lauthals zugestimmt: „Gut, dass endlich was geschieht!“ Ich sagte in meiner zornigen Rede: „Der Wissenschaftsbetrieb darf nicht in vornehmer Reserviertheit wegsehen und tatenlos beiseite stehen. Ich gehöre einer politischen Generation an, die zu den rechtsextremistischen Ausschreitungen nicht schweigen kann und darf. Auch wir Wissenschaftler sind herausgefordert, gegen alle Formen barbarischer Verwilderung unseres sozialen und politischen Lebens klar und entschieden Stellung zu nehmen.“
Es hatte an politischer Sensibilität gemangelt. Am Abend des 9.November 1992 waren auf Einladung des Passauer Oberbürgermeisters, des niederbayerischen Regierungspräsidenten und der Universitätsleitung 6.000 Studentinnen und Studenten zur fröhlichen Leberkäs-Speisung und Biertränke in die Nibelungenhalle gekommen. An der stadtoffiziellen Kundgebung gegen den Ungeist von rechts, die am 4. Dezember stattfand, nahmen hingegen nicht einmal zwei Dutzend Studierende teil. Die Eröffnung des Wintersemesters mit der traditionellen Leberkäs-Speisung, die 30.000 Deutsche Mark kostete, war der Universitätsleitung und der angehenden Akademikerschaft wichtiger als eine gemeinsame Demonstration gegen rechtsradikale Gewalttäter, Fremdenhass und Antisemitismus. Diese Gleichgültigkeit machte und macht mich bis heute zornig.
(Auszüge meiner Rede in: INSIDE. Monatsmagazin für Passau und Umgebung. Ausgabe 5, 2, Jg., Jan. 93, S. 6f)